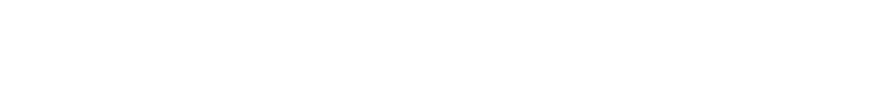Risikoprävention durch Veränderungsbereitschaft
Gewohnte Sicht- und Verhaltensweisen abzulegen, fällt nicht nur privat schwer, sondern auch im betrieblichen Umfeld. Bei sich wandelnden externen Anforderungen mündet mangelnde Veränderungsbereitschaft oft in einer wirtschaftlichen Gefährdung. Diesem Risiko kann durch gezieltes Change-Management begegnet werden.
In der Wirtschaft und der Welt allgemein geben schon seit geraumer Zeit permanente Veränderungen und eine stetig zunehmende Komplexität den Ton an. Vor diesem Hintergrund stehen Unternehmen vor besonderen Herausforderungen – und insbesondere der digitale Wandel stellt immer höhere Ansprüche an Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben wollen. Aber auch um Veränderungen im Rahmen externer Krisen effektiv zu bewältigen, bedarf es in Unternehmen einer grundlegenden Bereitschaft für Lösungen und Verhaltensweisen.
Ein nachhaltig implementiertes Change-Management (oder Veränderungsmanagement) befähigt Unternehmen, jederzeit auch plötzliche Veränderungen anzunehmen und produktiv mit diesen umzugehen. Change-Management ist somit elementarer Teil der Risikoprävention in Organisationen. Denn nur Unternehmen, die offen für anstehende Veränderungen und in der Lage sind, Wandel proaktiv und vorausschauend zu managen, können in einer sich kontinuierlich verändernden Welt erfolgreich sein.
Was ist Change-Management?
Unternehmen mit einem effektiven Change-Management schaffen es, ihre Strategien, Systeme, Prozesse und Strukturen an die sich ständig wandelnden äußeren Bedingungen anzupassen. Dazu gehören wirtschaftliche und technische, aber auch gesellschaftliche und soziale Veränderungen, wie man am Beispiel der Corona-Krise gut erkennen kann.
Um die Bereitschaft herzustellen, jederzeit angemessen auf Veränderungen reagieren zu können, sind aufwendige Prozesse des organisationalen Lernens nötig. Diese zielen auf die Veränderung von Organisationskulturen ab – also die Kultur, die Führungsrichtlinien von Unternehmen sowie die sich daraus ergebenden Systeme und Praktiken umfasst. Die Unternehmenskultur kann als Begrenzung eines Spielfelds gesehen werden, innerhalb derer sich alle anderen Aktivitäten ereignen. Ihr Einfluss ist also allgegenwärtig.
Um die Unternehmenskultur nachhaltig zu beeinflussen, sind Veränderungen in den Einstellungen und dem Verhalten der Mitarbeiter, aber auch in den Werten und Normen auf der Gruppen- und organisationalen Ebene sowie in den Praktiken des Personalmanagements unvermeidlich.
So existieren verschiedene Modelle, die den Ablauf sozialer Veränderungen in Organisationen und Gesellschaften veranschaulichen. Das Modell von John P. Kotter, Professor für Führungsmanagement an der Harvard University, ist besonders populär und findet nicht nur in der Forschung, sondern auch in der strategischen Unternehmensführung Anwendung. Das Modell führt acht erfolgskritische Phasen auf, derer man sich für ein erfolgreiches Change- Management annehmen muss:
- Gefühl der Dringlichkeit wecken
- Führungsteam zusammenstellen
- Entwickeln einer Vision und Strategie
- Kommunizieren der Vision: Verständnis und Akzeptanz erreichen
- Mitarbeiter befähigen: Hindernisse aus dem Weg räumen und Handlungsspielräume schaffen
- Kurzfristige Ziele und Erfolge aufzeigen
- Veränderungen weiter vorantreiben (nicht nachlassen!)
- Für Nachhaltigkeit sorgen: erreichte Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern
Während die ersten drei Phasen dazu dienen, ein Klima für den Wandel zu schaffen, geht es in den darauffolgenden drei darum, das Unternehmen beziehungsweise die Mitarbeiter mit dem Wandel zu beauftragen und dafür zu befähigen. Die letzten beiden Phasen dienen der Umsetzung und der Festigung der neuen Kultur.
Im Unterschied zu älteren Change-Management-Modellen berücksichtigt das Modell von Kotter, dass es in den meisten Unternehmen kaum noch eine abschließende Phase gibt, in der die Veränderungen verfestigt werden. Vielmehr befinden sich Unternehmen heutzutage in dauerhaften Veränderungsprozessen. Hinzu kommt, dass Veränderungsprozesse immer seltener in der gesamten Organisation stattfinden, sondern die Teilbereiche von Unternehmen jeweils eigene Change-Management-Prozesse durchlaufen. Die Folge sind immer kleinere zeitliche Abstände zwischen den einzelnen Change-Prozessen. Change-Management wird zum festen Teil der Unternehmenskultur und dient der Risikominimierung.
Wie lässt sich die Unternehmenskultur nachhaltig verändern?
In der Organisations- und Unternehmensentwicklung ist man schon seit Mitte der 1980er- Jahre der Ansicht, dass sich organisationale Strukturen vor allem dann verbessern lassen, wenn man den psychosozialen Prozessen zwischen Individuen und Gruppen mehr Aufmerksamkeit schenkt und die Menschen selbst in die Änderungsprozesse miteinbezieht. Das sogenannte „personal growth movement“ sieht das Individuum im Mittelpunkt und als Schlüsselfigur für echte, nachhaltige Veränderungen in Organisationen. Nach dieser Vorstellung kann das Potenzial einer Organisation, zu lernen und sich dadurch weiterzuentwickeln, immer nur so groß sein wie das ihrer Mitglieder.
Ohne individuelles Lernen gibt es also keine lernende Organisation. Das heißt, es ist nicht so sehr die Organisation als Ganze, die Ziele für sich definieren und anstreben muss. Stattdessen sind es vor allem die Mitglieder, die die Fähigkeit entwickeln müssen, eine persönliche Vision zu verfolgen und kontinuierlich auf diese hinzuarbeiten. Das kann nur gelingen, wenn die einzelnen Mitarbeiter sich ihre Ziele immer aufs Neue vor Augen halten, diese mit der Realität abgleichen und sich bewusst machen, wo sie sich im Verhältnis zum Ziel gerade befinden – und nicht in kontraproduktiven Beziehungen verharren.
Die Entwicklung persönlicher Visionen auf individueller Ebene steht also im Vordergrund: Wenn die Mitarbeiter nicht selbst motiviert sind, sich den herausfordernden Aufgaben des Wachstums und der technischen Entwicklung zu stellen, wird es einfach kein Wachstum geben – und damit auch keine Produktivitätssteigerung und keine technische Weiterentwicklung. Übertragen auf die Veränderungsbedarfe im Bereich der Digitalisierung bedeutet dies: Ohne die Grundüberzeugung der Mitarbeiter vom Wert neuer digitaler Lösungen werden diese auch nicht zu erreichen sein.
Unternehmen in der Krise – Change- Management als Teil der unternehmensweiten Risikoprävention
Doch was sind Anlässe und Auslöser für das Initiieren von Change-Projekten in Organisationen? Veränderungsprozesse sind immer dann nötig, wenn das Unternehmen einen strategischen Wendepunkt erreicht. Dies kann beispielsweise beim Eintritt in einen neuen Markt der Fall sein, wenn das Unternehmen plötzlich starken Wettbewerb erlebt. Auch wenn es um die Einsparung von Kosten oder die Einführung neuer Technologien geht, stehen oft aufwendige Change-Prozesse an. Der Grund kann aber auch sein, dass das Unternehmen einen grundlegenden Kultur- und Wertewandel braucht – etwa wenn es um die Ansprache neuer Zielgruppen geht.
Ein weiteres sehr aktuelles Beispiel ist die Corona-Krise, durch die der Druck zur Digitalisierung für private wie öffentliche Institutionen immer dringlicher und sogar unvermeidbar wird. Dieser Veränderungsbedarf ist allerdings nicht neu, es gibt ihn schon seit einigen Jahren. Offensichtlich hatten viele Akteure aber bisher zu wenig Anreiz, um wirkliche Veränderungen anzustoßen – sei es bei Entwicklungen im Home- office oder im Bereich des digitalen Lernens.
Die Corona-Krise zeigt nun, wie schnell sich Dinge verändern können, wenn es keinen anderen Weg gibt. Anders formuliert: Die Krise brachte den Druck, den es brauchte, um Veränderungen umzusetzen. In den letzten Monaten haben sich viele Unternehmen an die veränderten Arbeitsbedingungen angepasst und Möglichkeiten für das Homeoffice sowie für Online-Konferenzen und -Präsentationen geschaffen. Große Headquarter-Büros werden vielerorts obsolet, stattdessen werden die Möglichkeiten zur Verlängerung ins Internet konsequenter genutzt.
Wie man in der Krise aber auch beobachten konnte, ist die Fähigkeit von Organisationen, Trends frühzeitig zu erkennen, angemessen zu interpretieren und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, nach wie vor eingeschränkt. In vielen Unternehmen führte das dazu, dass schnelles Handeln als nicht dringlich eingestuft wurde und daher Entscheidungen zu zögerlich getroffen und Maßnahmen zu spät initiiert wurden.
Um solche Fehler in der Wahrnehmung der Entscheidungsträger und der handelnden Akteure in Zukunft zu vermeiden, gilt es, größtmögliche Transparenz herzustellen. Denn Krisen- und Risikomanagement ist dann erfolgreich, wenn alle Betroffenen möglichst umfassend informiert werden und sich in das Geschehen eingebunden fühlen.
Einwegkommunikation reicht dabei nicht aus. Gute Kommunikation in der Krise bedeutet intensive Gespräche zwischen allen Interessengruppen sowie die Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf andere Sichtweisen einzulassen. Das liegt schon alleine daran, dass es in Unternehmen, wie in allen sozialen Systemen, viele unterschiedliche Perspektiven und Interessenlagen gibt. Nur selten sind sich Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter völlig einig, wenn es um das Anstoßen von Veränderungen geht. Es gilt also, Visionen zu den wichtigsten Fragestellungen und Herausforderungen zu entwickeln, die von der Mehrheit der Beteiligten getragen werden. Die Entwicklung einer gemeinsamen Vision ist ein wesentlicher Schritt im Change-Management. Nur so wird eine breite Unterstützung und Akzeptanz für notwendige und gegebenenfalls unattraktive Maßnahmen erreicht.
Lernen aus der Krise – wie müssen Unternehmen zukünftig mit Veränderungen umgehen?
Eine Krise (aus dem Griechischen für „Zuspitzung″ oder „Entscheidung“) markiert den Wendepunkt einer Entwicklung. Sie zeigt auf, dass es so mit bestimmten Dingen nicht weitergeht. Vor Corona und Homeoffice fehlte Entscheidungsträgern sowie Mitarbeitern in Unternehmen oft die Einsicht oder der Grund, warum bestimmte digitale Lösungen ihnen konkret helfen könnten. Heute ist das vielerorts anders und der Grundstein für die Entwicklung unternehmensweiter Change-Management-Prozesse ist gelegt. Voraussetzung für solche Veränderungen ist jedoch der Mut zu einem radikalen Umdenken und eine kontinuierliche Reflexion des Geschehens. Grundsätzliche Missstände müssen umfassend aufgearbeitet werden und in Veränderungen überführt werden.
Um das zu erreichen, müssen Unternehmen in der Lage sein, verschiedene Perspektiven, Einschätzungen und Beurteilungen zuzulassen. Außerdem muss die Unternehmenskultur derart ausgestaltet sein, dass eine offene und wertschätzende Kommunikation (auch über unangenehme) Themen möglich ist. Ein Prinzip, das hierfür nicht genug betont werden kann, ist Transparenz. Je transparenter die Führungsetage mit den ihr zur Verfügung stehenden Informationen umgeht, umso eher können wichtige Signale aus dem Unternehmen selbst, aber auch aus dem Unternehmensumfeld angemessen interpretiert und diskutiert werden. Das Ergebnis sind nachvollziehbare Entscheidungen, die von der Mehrheit der Beteiligten getragen werden.
Wichtig für Unternehmen wird es in Zukunft sein, allen Mitarbeitern Raum zu geben, alternative Wege einzuschlagen. Change-Management funktioniert nur, wenn es genug Raum für Kreativität, Feedback und Reflexion und außerdem eine tolerante Fehlerkultur gibt. Führungskräfte müssen lernen, Verantwortung abzugeben und die Potenziale ihrer Teams über Hierarchieebenen hinweg zu aktivieren. Viele Führungskräfte sind sich ihrer Verantwortung für den Change-Prozess noch nicht bewusst und wissen nicht, dass nur die aktive Einbindung von Mitarbeitern bei Veränderungen zum Erfolg führt. Einer der ersten Schritte des Change-Managements in Unternehmen muss es also sein, die klassische Idee von Führung zu einer Rolle als Coach und Mentor zu wandeln.
Fazit
Digitale Technik ist in Zeiten von Corona in vielen Settings unerlässlich, um arbeits- und handlungsfähig zu bleiben. Lockdown und Kontaktverbot stellen deshalb für viele Unternehmen Beschleuniger der digitalen Transformation dar. Die Krise bietet also die Chance, im Bereich Change-Management schneller ans Ziel zu kommen und Veränderungsbemühungen zu reaktivieren.
Unternehmen, die erfolgreich Change-Management betreiben, unterliegen einer ständigen Transformation, die aus externem Druck, aber auch aus einer inneren Entwicklung hervorgeht. Dafür bedarf es bestimmter Strategien und Veränderungsmechanismen – welche davon in welcher Form und an welchem Ort wirken oder nicht, lässt sich zurzeit weltweit mitverfolgen. Die Corona-Krise ist – wie alle Krisen – ein Crashkurs in Sachen Change-Management. An ihr lässt sich beobachten, wie unterschiedlich man mit Veränderungen umgehen kann.
Wer Defizite im eigenen Unternehmen bemerkt – egal, ob es soziale oder wirtschaftliche sind – muss zeitnah handeln. Wer aus der Erfahrung keine Konsequenzen zieht und nicht erkennt, wie wichtig Reaktionsschnelligkeit in Zeiten der ständigen Veränderung ist, den trifft die nächste Krise noch heftiger.
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie gerne Ihre nächstgelegene HSP-Kanzlei an.
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns gerne an.