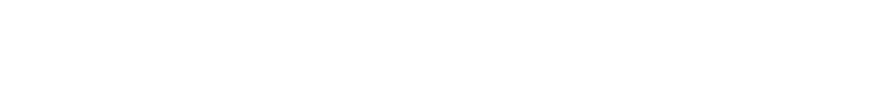Gelangensbestätigung: noch mehr Formulare
Eine neue Dokumentation soll Umsatzsteuerbetrug bei Lieferungen zwischen den EU-Staaten eindämmen. Solange noch um das Bürokratie-Monster namens Gelangensbestätigung gestritten wird, gelten die alten Regelungen weiter.
Autorin: Midia NuriVeronika von Treskow will ihre Empörung nicht verbergen. „Es ist unglaublich, dass wirtschaftsferne Experten eine so weitreichende und für Unternehmen belastende Regelung planen“, schimpft die Prokuristin der Technoplast v. Treskow GmbH, einer Vertriebsgesellschaft für technische Kunststoffe in Lahnstein bei Koblenz. Schon als sie zum ersten Mal von dem Vorhaben hörte, war ihr klar: Die Novellierung der Nachweispflichten für die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung bedeutet für ihren Betrieb einen enormen Zusatzaufwand. „Wir müssten jeden unserer Kunden in den EU-Staaten einzeln bitten, den Erhalt einer Lieferung auf dem vorgeschriebenen Formular zu quittieren“, fürchtet von Treskow. „Wie soll das denn gehen?“ Telefonieren. Briefe schreiben. Jeder Lieferung Briefumschläge mit Rückporto beilegen. Es dürfte viel Zeit und Geld kosten, wenn Exporteure künftig die von der Bundesregierung geplante sogenannte Gelangensbestätigung vorlegen müssen, damit eine Lieferung ins EU-Ausland steuerfrei bleibt.
Komplizierter Nachweis. Mit diesem einheitlichen Vordruck soll der grenzüberschreitende Umsatzsteuerbetrug eingedämmt werden. Doch quer durch alle Branchen laufen die Wirtschaftsverbände dagegen Sturm. Das Bundesfinanzministerium hat daher ein Schreiben, das die Neuregelung paxisnäher gestalten soll, bereits zum zweiten Mal verschoben. Nun soll eine weitere Änderung der Durchführungsverordnung Abhilfe schaffen. Wann und in welcher Form, ist noch offen.
Um Steuerfreiheit zu erlangen, bleibt es daher in einer Übergangsphase bei der alten Regelung. Liefert ein deutscher Unternehmer eine Ware in ein anderes EU-Land, muss er nachweisen, dass sie ins Gemeinschaftsgebiet befördert wurde. Er hat dann auf den Warenwert keine Umsatzsteuer ans Finanzamt zu zahlen.
Welchen Nachweis er dafür erbringen muss, richtet sich bisher danach, ob das Unternehmen selbst, ein von ihm oder dem Abnehmer beauftragter Lieferant oder der Abnehmer selbst den Gegenstand befördert. Je nach Konstellation kann dieser Nachweis kompliziert werden.
Keine echte Verbesserung. Um das Verfahren zu vereinfachen, trat bereits zum Jahresbeginn die Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) in Kraft. Sie sieht vor, dass die Rechnungskopie sowie die neue, für alle erdenklichen Liefervarianten einheitlich gestaltete Gelangensbestätigung in Zukunft die bisherigen Nachweise ersetzen. So sollen Unternehmer für alle Liefervarianten standardisiert nachweisen können, dass der von ihnen verkaufte Gegenstand, für den sie die Umsatzsteuerfreiheit beanspruchen, auch tatsächlich in einem EU-Mitgliedstaat angekommen ist. Der Außenhandel erhalte dadurch eine „einfachere und eindeutige Nachweisregelung“, versprach der Entwurf der Verordnung von Oktober 2011.
Doch was sich so schlicht und schlau anhört, ist für exportierende Unternehmen in der Praxis kaum zu leisten. Wie sollen sie zum Beispiel kontrollieren, ob wirklich eine befugte Person die Gelangensbestätigung unterzeichnet? Und wie können sie sicherstellen, dass der Kunde das ihm unbekannte Formular nach der Lieferung zeitnah ausfüllt – zumal vermutlich viele Abnehmer die vorgeschriebenen Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch gar nicht beherrschen?
Hoher Bürokratieaufwand. Verschiedene Wirtschaftsverbände sowie Kammerorganisationen protestierten gegen die Neuregelung. In dieser Form würden die Nachweispflichten „insbesondere kleine und mittlere Unternehmen erheblich belasten“, bemängelt unter anderem Wilfried Hollmann, Präsident des Mittelstandsverbunds in Berlin. Er nennt als Beispiele unter anderem die Versender von Auto- oder sonstigen kleineren Ersatzteilen sowie von Büchern, Kleidung oder von Elektronikzubehör.
Gerade Mittelständler müssten mit deutlichem Mehraufwand und hohen Kosten kämpfen und hätten keine personellen oder finanziellen Kapazitäten, um bei Abnehmern im EU-Ausland die Unterzeichnung der Gelangensbestätigung durchzusetzen. „Damit ist für die Firmen die Steuerfreiheit ihrer Exporte bedroht“, fürchtet Hollmann. Industrie- und Handelskammern machten Druck mit dem Umfrageergebnis, bis zu 20 Prozent der betroffenen Unternehmen könnten wegen der Neuerung einen Teil ihres Vertriebs ins europäische Ausland verlagern.
Für Technoplast gäbe es durch die Gelangensbestätigung bei jeder zehnten Lieferung zusätzlichen Aufwand: Im Schnitt sind das täglich 35 Bestellvorgänge. Die derzeitige Änderung der Verordnung betrifft ausgerechnet das aufwendige Geschäft mit Kleinbestellungen, die über den Online-Shop hereinkommen – vor allem von kleinen Werkstätten und anderen Verarbeitern in Österreich und den übrigen Nachbarstaaten. Dieser Vertriebsweg würde zum Problem, denn über den Online-Shop werden oft Artikel aus dem Niedrigpreissektor verkauft. Veronika von Treskow zeigt eine Rechnung vom Vortag über einen Kunststoffstab für 17,95 Euro. „Abzüglich zehn Prozent Neukundenrabatt, plus Versandkostenpauschale“, sagt sie. „Bei solchen Preisen würde der Verkauf durch den zusätzlichen bürokratischen Aufwand unwirtschaftlich.“
Übergangsweise kann auf die Gelangensbestätigung verzichtet werden. Wenn die geplante Neuregelung jedoch nicht noch durch in Aussicht gestellte Alternativen ergänzt wird, könnte sie das Aus für viele kleinere Lieferungen aus Deutschland in andere EU-Staaten bedeuten.